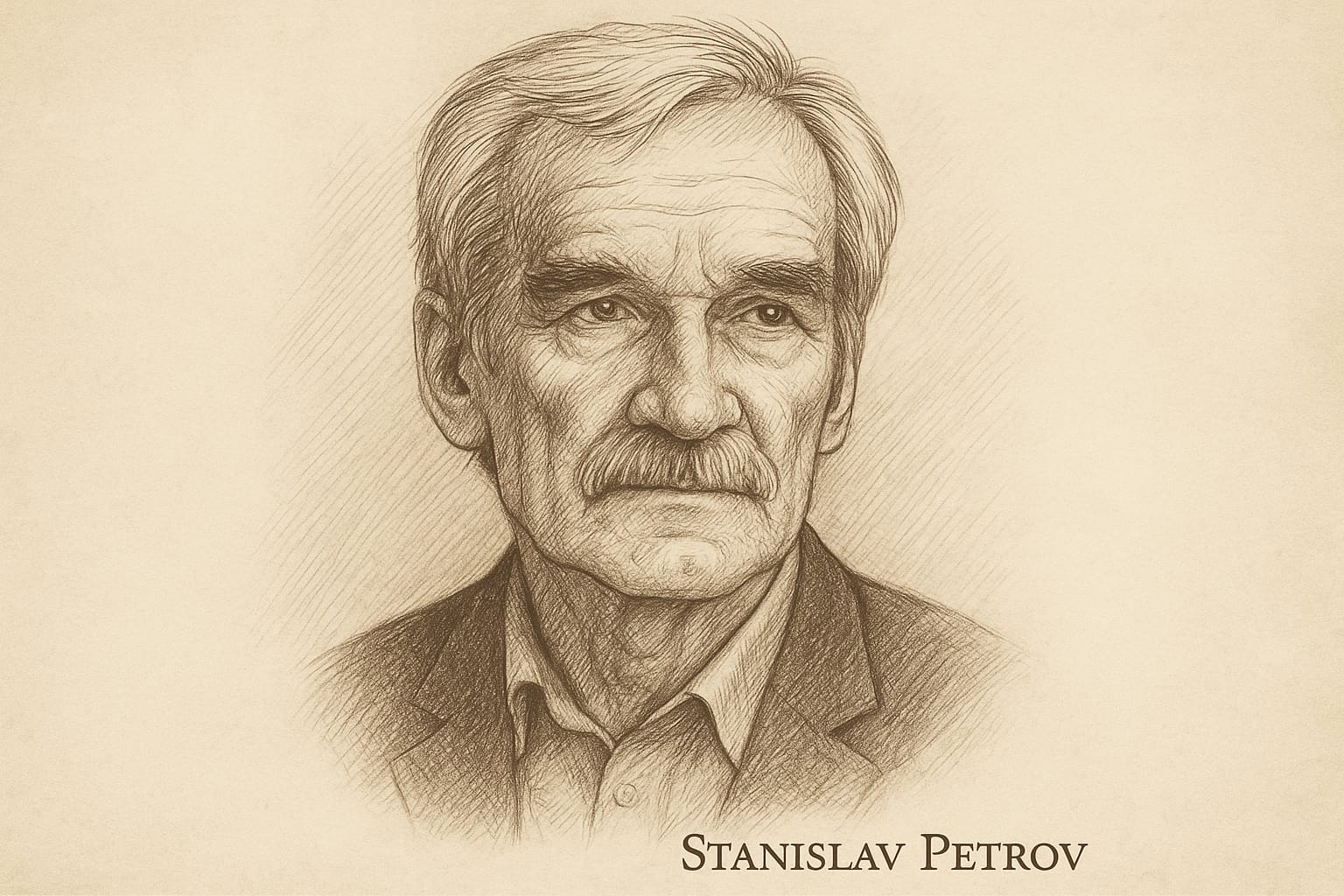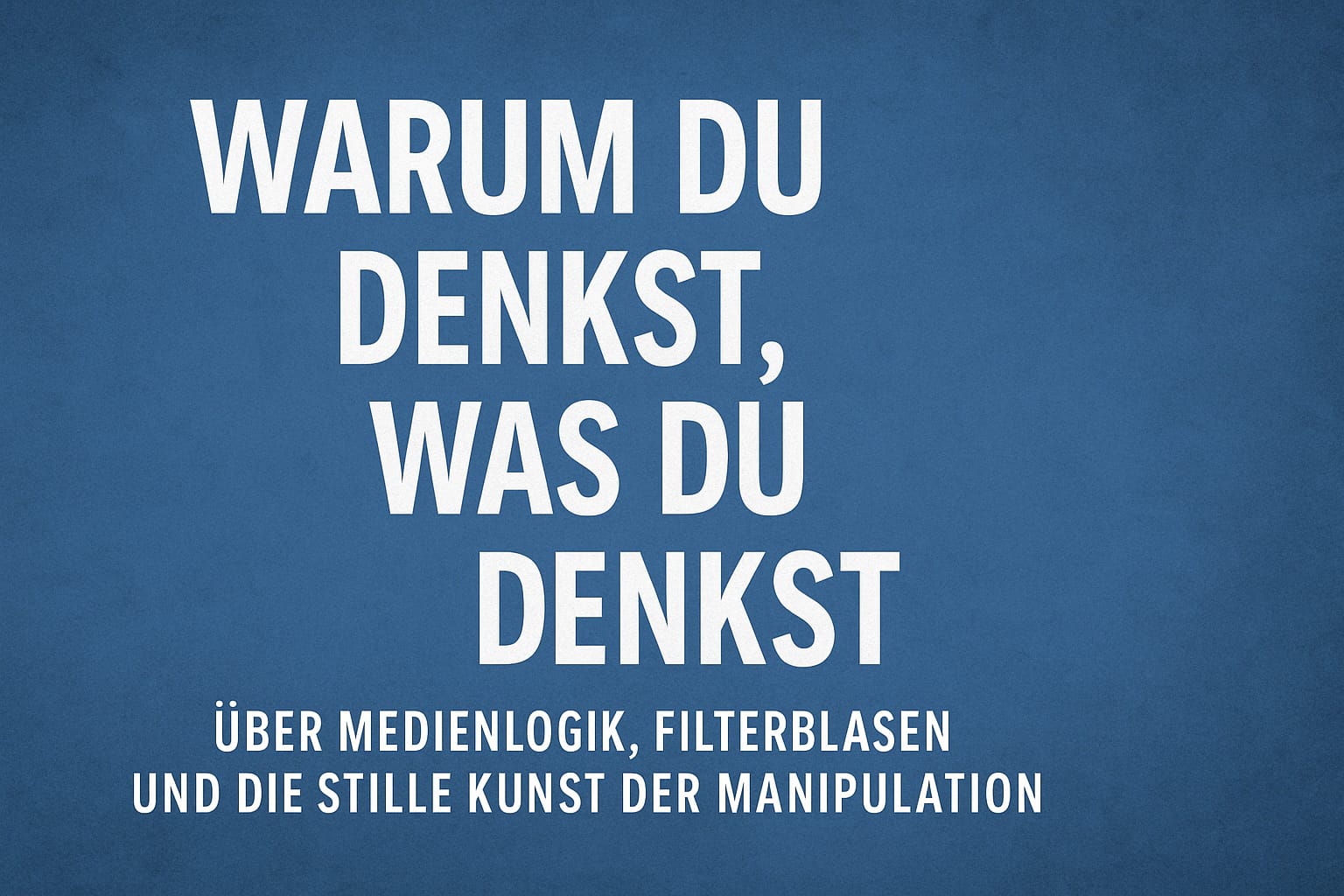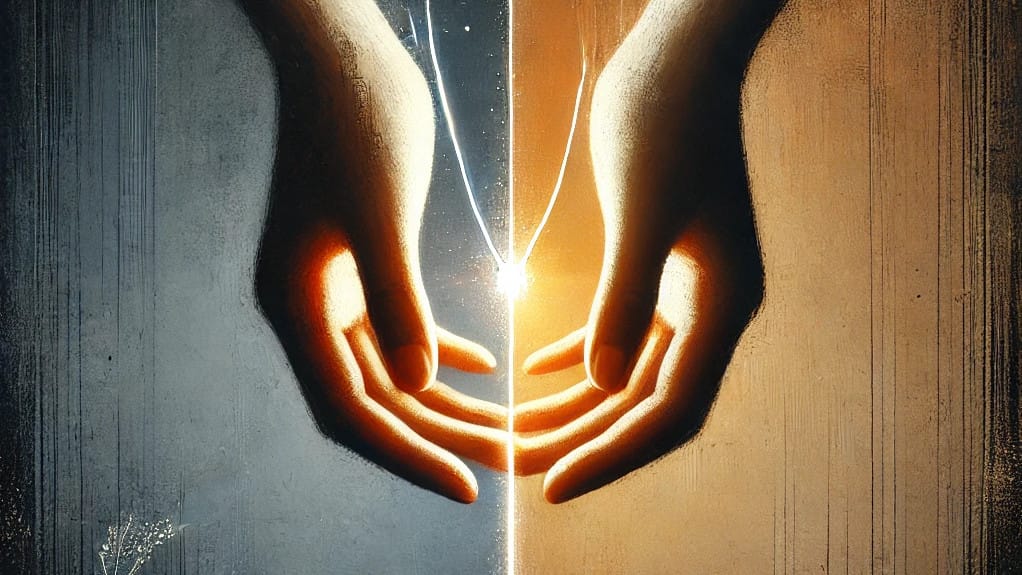Prolog: Für die, die es nicht erlebt haben
Die Szene in Ost-Berlin in den 90er-Jahren ist schwer zu erklären, wenn man nicht dabei war.
Die frühen 90er in Berlin – das war keine bunte Retrozeit mit Techno, Dosenbier und Clubkultur. Es war roh. Chaotisch. Aufgeladen. Man wusste oft nicht, ob man auf der Straße einem Freund begegnet oder jemandem, der einem den Schädel einschlägt. Besonders im Friedrichshain, wo ich damals lebte, und drüben in Lichtenberg, jenseits der Bezirksgrenze. Das waren keine Postleitzahlen, das waren Reviere.
Wer zur „Szene“ gehörte – ob links oder rechts – der trug das sichtbar. In der Kleidung. Im Auftreten. In der Sprache. Und er wusste, dass es jederzeit ernst werden konnte. Der Begriff „Kampfzone“ war keine Übertreibung. Leute wurden aus fahrenden S-Bahnen geworfen oder mit Baseballschlägern schwer verletzt und hin und wieder gab es auch Tote. Und doch gab es darunter eine Realität, die kaum einer sieht, wenn er heute über diese Zeit spricht.
Die Szene bestand nicht nur aus „den Linken“ und „den Rechten“. Es gab harte Kerne – Leute, die Ideologie lebten, Führungsfiguren, die etwas zu sagen hatten. Und es gab die Mitläufer. Menschen, die irgendwie hineingerutscht waren, aus Langeweile, aus Gruppenzwang, auf der Suche nach Zugehörigkeit. Manchmal konnte man kaum sagen, wer da eigentlich wofür stand. Es ging nicht immer um politische Überzeugung. Oft ging es um Dazugehören. Um Haltung. Um Stärke.
Ich selbst war klar verortet: Hausbesetzer-Szene, links, Rigaer, Mainzer Straße. Man erkannte mich sofort. Ich passte in mein Lager. Und trotzdem war ich in der Lage, mich zwischen den Fronten zu bewegen. Nicht, weil ich mich verstellte. Sondern weil ich Menschen kannte. Von früher. Aus der Schule. Aus der Kindheit. Und weil ich mich weigerte, diese Verbindungen einfach zu kappen, nur weil jemand jetzt eine Glatze trug oder „Zecke“ sagte.
Was ich damals erlebt habe, war nicht alltäglich – aber für mich auch nicht ungewöhnlich. Es waren Begegnungen, die heute völlig unmöglich erscheinen: Linke und Rechte, die gemeinsam an einem Abend auf einer Matratze sitzen, saufen, Musik hören und einfach für ein paar Stunden Menschen sind. Keine Parolen. Keine Feindbilder. Keine Rollen. Nur Menschen.
Es klingt verrückt, wenn man es heute erzählt. Und vielleicht war es das auch. Aber es ist passiert. Mehr als einmal. Und vielleicht ist genau das der Punkt: Es gab diese kleinen Risse in der Realität. Diese unsichtbaren Räume, in denen der Hass mal kurz Pause machte. Nicht weil wir ihn besiegt hatten – sondern weil wir einfach nicht mitgemacht haben.
Darüber möchte ich erzählen.
Links verortet, aber nicht verengt
Ich war ein Linker. Das war keine Frage, sondern eine Haltung, ein Lebensstil, ein Milieu. Ich lebte in besetzten Häusern in der Rigaer Straße und auch in der Mainzer. Wir hatten unsere Codes, unsere Kreise, unsere gemeinsame Wut. Gegen den Staat, gegen Nazis, gegen Kapitalismus, gegen alles, was wir für falsch hielten.
Es war eine Zeit, in der du wusstest, wo du hingehörst. Und wo nicht.
Meine Kleidung hat mich eindeutig erkennbar gemacht. Ich hätte mich niemals in Lichtenberg an einer Bushaltestelle zeigen können, ohne dass es gefährlich geworden wäre. Und umgekehrt wussten auch die Rechten ganz genau, wo bei uns Schluss war. Es gab eine klare Frontenordnung – nicht auf dem Papier, sondern in der Luft. Spürbar. Überall.
Und doch – ich passte nicht ganz in dieses System. Oder besser: Ich ließ es nicht zu, dass mich die Szene vollständig formte.
Ich kannte Leute auf der anderen Seite. Leute, mit denen ich zur Schule gegangen war. Leute, mit denen ich als Kind gespielt hatte. Einige davon waren mittlerweile tief in der rechten Szene – wirklich tief. Keine Mitläufer, sondern prägende Gestalten. Und trotzdem begegnete ich ihnen mit einem gewissen Respekt. Nicht für ihre Ideologie – sondern für die Tatsache, dass wir gemeinsame Wurzeln hatten. Gemeinsame Geschichte.
Ich glaube, das war mein Schutz. Ich war niemand, der große Reden schwang oder sich ständig politisch erklärte. Ich war einfach ich. Und irgendwie haben das viele gemerkt – auch die auf der anderen Seite.
Vielleicht hat mir das den Zugang ermöglicht. Vielleicht auch, dass ich keine Angst hatte. Oder dass ich nicht verurteilend auf andere zugegangen bin. Ich konnte reden, zuhören, Grenzen wahren – und gleichzeitig Beziehungen halten, wo andere schon lange aufgegeben hatten. Das war keine Strategie. Es war einfach mein Weg.
Ich war klar verortet, ja. Aber nicht verengt. Und das hat mir Türen geöffnet, die für andere längst zugeschlagen waren.
Die Begegnungen – Wenn aus Feinden Gäste werden
Es waren keine großen Ereignisse. Keine Friedensgipfel, keine politischen Aktionen. Nur Partys. Ganz normale, dreckige, verrauchte, laute Berliner Partys Anfang der 90er. Matratzen auf dem Boden. Musik aus klappernden Boxen. Eine Flasche in der Hand, manchmal zwei. Irgendwer hatte ein paar Kerzen hingestellt, irgendwer anders einen Hund mitgebracht. Und irgendwo war immer jemand am Pennen oder am Streiten oder am Tanzen.
So liefen unsere Wochenenden ab. Fast immer. Es war nicht viel, aber es war unser Leben.
Und dann kam dieser eine Abend. Oder besser: diese Abende, denn es passierte mehr als einmal. Ich hatte unterwegs ein paar Leute getroffen – einen alten Bekannten aus der rechten Szene, ein Skin, ziemlich hart drauf, den anderen kannte ich aus meiner Schulzeit. Ebenfalls tief rechts, nicht einfach nur Sympathisant, sondern wirklich mittendrin. Beide gewaltbereit. Beide keine Unbekannten in ihrer Szene.
Ich erzählte einfach so, wie man eben redet: „Ey, Samstag ist wieder Besäufnis bei mir. Bring deine Freundin mit, eine Flasche, du weißt ja.“ Keine große Sache. Keine Einladung mit Hintergedanken. Ich dachte nicht einmal darüber nach, ob das geht oder ob das klug ist. Für mich waren das Leute, die ich kannte. Fertig.
Und sie kamen. Und da waren auch Leute aus der linken Szene. Menschen, mit denen ich Häuser besetzt, Demos gemacht, Nächte durchlebt hatte. Auch keine Unbekannten. Und plötzlich saßen da Menschen im selben Raum, die sich auf der Straße gegenseitig gejagt hätten.
Am Anfang war es still. Die Stimmung war gespannt. Man spürte das kurze Zögern, das Misstrauen, das Abtasten. Jeder wusste, mit wem er es zu tun hatte. Es war kein Zufall, keine Verwechslung – es war klar: Hier sitzen Leute, die ideologisch eigentlich Feinde waren. Und trotzdem passierte… nichts.
Ich weiß nicht genau warum. Vielleicht, weil ich dazwischenstand. Vielleicht, weil alle wussten: Wenn ich das mache, dann muss das irgendwie in Ordnung sein. Ich war damals kein Kind von Traurigkeit. Ich konnte für Ordnung sorgen. Und ich hatte offenbar den Respekt von beiden Seiten. Nicht, weil ich stark war – sondern weil ich ehrlich war. Weil ich niemanden verarscht habe. Und weil ich niemanden verurteilt habe.
Und dann war es wie immer. Musik, Gelaber, Saufen, Lachen. Der Abend floss dahin. Die Flaschen kreisten. Die Themen wurden lockerer. Und irgendwann war nicht mehr wichtig, wer links war und wer rechts. Nur der Moment zählte. Das Menschliche. Die Erinnerung daran, dass man sich kannte. Nicht als Ideologieträger. Sondern als Typen, die sich mal in einer Schulklasse den Bleistift geklaut hatten.
Das war keine Utopie. Keine Versöhnung. Es war einfach nur ein Abend, an dem die Welt kurz aufgehört hat, in Feindbildern zu denken. Und das Verrückte: Es war für uns alle irgendwie normal. Nicht im politischen Sinn. Sondern im menschlichen.
Freundschaften, die über Szenegrenzen hinausgingen
Ich kannte sie alle von früher. Nicht aus politischen Kreisen, sondern vom Bolzplatz, vom Schulhof, aus der Kneipe an der Ecke. Wir hatten zusammen Flipper gespielt, uns Prügeleien mit anderen Jungs geliefert, manchmal auch miteinander. Wir kamen aus derselben Gegend, hatten denselben Dreck an den Schuhen, dieselben Eltern mit wenig Geld und viel Frust, dieselben kaputten Schulen und denselben Zwang, irgendwo da draußen bestehen zu müssen.
Und dann – irgendwann – trennten sich die Wege. Der eine rutschte in die linke Szene, der andere in die rechte. Manchmal war es nur eine Clique, die den Ausschlag gab. Manchmal Musik. Oder ein älterer Bruder. Es waren keine tiefen Überzeugungen am Anfang. Eher Strömungen, in die man hineingezogen wurde.
Du hörtest plötzlich Oi!-Punk oder Slime, trugst Docs oder Chucks, gingst zur Demo oder zur Hool-Schlägerei – und plötzlich warst du „drin“.
Aber drunter, ganz unten drunter, war da immer noch die Erinnerung. An gemeinsame Abende. Gemeinsame Mädchen. Gemeinsame Angst vorm Lehrer. Und genau diese Schicht blieb bei einigen bestehen – trotz all der Härte, die später kam.
Ich erinnere mich an einen Typen, den ich fast vergessen hatte. Jahrzehnte später, irgendwo am Stadtrand, sind wir ins Gespräch gekommen – wegen seiner Hündin, die mit meinem Hund rumtollte. Wir kamen ins Reden. Und auf einmal fiel ein Name. Und noch einer. Und dann merkten wir: Wir kannten uns. Von damals. Aus dieser Zeit, wo es noch nicht um Lager ging, sondern einfach ums Klarkommen. Zwei Veteranen die viel erlebt hatten.
Er war damals auf der komplett anderen Seite. Und das meine ich wörtlich: ideologisch, körperlich, gewaltbereit. Und trotzdem: Da war sofort diese Vertrautheit. Kein Misstrauen, kein Hass. Nur zwei alte Bekannte, die sich wiedertreffen und plötzlich merken, wie viel Zeit vergangen ist – und wie viel trotzdem geblieben ist.
Diese Art von Freundschaften – sie waren selten, aber sie existierten. Und sie haben überlebt, weil sie nicht auf Gesinnung gebaut waren, sondern auf gemeinsame Geschichte. Nicht auf Haltung – sondern auf Herkunft.
Das war kein Kuschelkurs. Wir wussten genau, wo wir politisch standen. Und wir hätten uns in einer anderen Situation vielleicht auch wieder angebrüllt oder geprügelt. Aber in diesen Momenten – in diesen seltsamen, echten Momenten – war das alles egal. Weil wir uns vorher schon kannten. Und weil wir irgendwo tief drinnen noch wussten, dass wir mal gleich angefangen hatten.
Am Tag danach – die Gewalt holt alle ein
Und dann war wieder Montag. Oder Dienstag. Oder einfach der nächste Tag. Der Moment war vorbei, der Abend verklungen, der Rauch verzogen. Und draußen war wieder Krieg.
Nicht mit Panzern. Aber mit Fäusten, Flaschen, Ketten, Worten, Blicken. Die Straßen in Friedrichshain und Lichtenberg kannten keine Gnade. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort war, wurde vermöbelt. Wer das falsche T-Shirt trug, wurde gejagt. Und wer Pech hatte, landete im Krankenhaus – oder schlimmer.
Ich hab selbst genug davon mitbekommen. Kopfplatzwunden, ausgeschlagene Zähne, Pfefferspray in der Lunge. Es war Alltag. Und es war brutal. Nicht nur zwischen Szenen, sondern auch innerhalb. Die Gewalt war nicht immer politisch. Manchmal war sie einfach da. Wie ein dumpfer Reflex. Wie ein schlafloser Dämon, der sich auf alles stürzte, was schwach roch.
Und in dieser Realität bewegten sich auch die Leute, mit denen ich noch Tage zuvor getrunken hatte. Ich sah sie auf der Straße – mit finsterem Blick, im Rudel, mit voller Härte. Ich wusste, was sie draufhatten. Und sie wussten, wo ich stand. Es wurde nicht gesprochen. Nur genickt. Oder gar nicht. Die Nähe vom Wochenende war wie ausgelöscht. Ein anderer Modus hatte eingesetzt. Einer, der keine Zwischenräume zuließ.
Ich fragte mich manchmal: Haben sie vergessen? Haben sie verdrängt? War der gemeinsame Abend eine Ausnahme – oder eine Lüge?
Aber ich glaube: Es war beides. Es war echt, was da auf der Matratze passiert ist. Und es war genauso echt, was dann wieder auf der Straße geschah. Das war kein Widerspruch – sondern einfach die Wucht dieser Zeit. Alles war extrem. Alles war schnell. Alles war instabil.
Manche konnten das trennen. Andere nicht. Ich glaube, ich war einer der wenigen, die in beiden Welten sehen konnten, ohne daran kaputtzugehen. Aber leicht war das nicht. Manchmal war ich zerrissen. Nicht, weil ich nicht wusste, wo ich hingehöre – sondern weil ich wusste, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gab. Und weil ich wusste, dass hinter den härtesten Typen oft einfach verlorene Jungs standen. Mit Wut, mit Schmerz, mit keiner Perspektive.
Und ja, manchmal hatte ich Angst. Nicht oft, aber manchmal. Weil ich spürte, wie dünn der Boden war, auf dem ich stand. Ein falsches Wort, eine falsche Geste – und du warst allein.
Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin dazwischengeblieben. Weil ich es konnte. Und weil ich nicht anders konnte.
Was bleibt – und was wir daraus machen könnten
Heute – Jahrzehnte später – frage ich mich manchmal, was das eigentlich war.
War es Mut, zwischen den Fronten zu stehen? Oder Naivität? War es ein Zeichen von Stärke, dass ich mit beiden Seiten reden konnte? Oder einfach nur das Ergebnis davon, dass ich nie aufgehört habe, Menschen als Menschen zu sehen?
Ich weiß es nicht.
Was ich aber weiß: Diese Begegnungen waren echt. Sie waren nicht geplant, nicht politisch, nicht als „Zeichen“ gedacht. Es waren keine Statements – es waren Abende. Mit Flaschen, mit Musik, mit Geschichten. Und mit der stillen Übereinkunft: Heute mal kein Hass. Heute mal kein Krieg.
Diese Momente haben mir gezeigt, dass unter all den Symbolen, Parolen und Posen immer noch Menschen steckten. Mit Erinnerungen. Mit Sehnsucht. Mit Brüchen. Und vielleicht – das ist das, was mich bis heute beschäftigt – mit dem Wunsch, irgendwann einfach mal rauszukommen aus dem ganzen Scheiß.
Ich glaube nicht, dass man die 90er verklären darf. Zu viele haben geblutet. Zu viele sind zerbrochen. Und zu viel wurde verschwiegen.
Aber ich glaube auch, dass man diese kleinen Inseln nicht vergessen sollte. Diese stillen Abende, an denen aus Feinden Gäste wurden. Nicht weil sie ihre Meinung änderten. Sondern weil sie sich noch an etwas erinnerten, das davor lag: an Kindheit, an Freundschaft, an gemeinsame Herkunft. An das Menschsein.
Vielleicht ist genau das die Botschaft, die bleibt. Dass wir nicht alles bis zum Äußersten zuspitzen müssen. Dass man auch heute – in einer Welt, die wieder in Lager zerfällt – mal eine Matratze hinlegen kann, eine Flasche aufmacht, Musik anmacht und sagt:
„Lass mal Mensch sein. Nur für einen Moment.“
Und vielleicht reicht das manchmal, um etwas zu verändern.
Zumindest im Kleinen. Zumindest im Inneren.
Immer auf dem Laufenden bleiben